Manfred Vogel: Else Lasker-Schüler, ein Gedenkblatt [*]
Aktualisiert: 1. April 2021
* * *
[1]
Else Lasker-Schüler
ein Gedenkblatt
von
Manfred Vogel
1945
Edition »Refta« Tel-Aviv
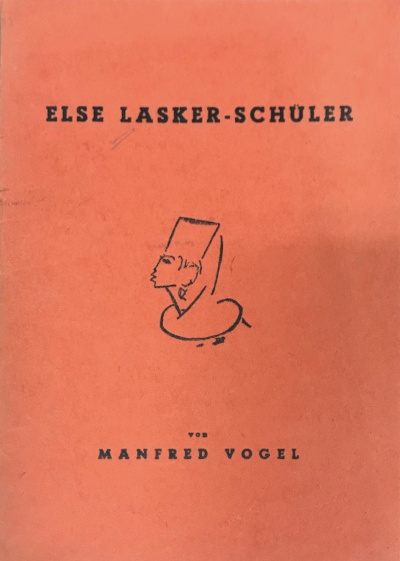
[...]
[23] [...] Wenn wir uns nun also auf einen kleinen Inspektionsgang durch die Requisitenhalle der Erinnerung begeben, so muss ich zunächst gestehen, dass ich von [24] meiner ersten Begegnung mit Else Lasker-Schüler nichts wusste. Das war im Frühjahr 1940 an einem kleinen Schuhputzerstand im Zentrum Jerusalems. Da thronte sie in einem gebrechlichen Korbsessel, ein wenig oberhalb des Strassenstaubes, sah dem ihre Schuhe bearbeitenden flinken Jungen sinnend zu, fütterte ihn die ganze Zeit mit Bonbons, und als der Vater des Jungen kam, ihm sein ärmliches Mittagsmahl brachte, nahm sie dem Kleinen spontan die Bürste aus der Hand, um sich, ungeachtet allen Protestes, weiterhin allein zu bedienen. Das war kein gestelltes Rührbild, ebenso wenig wie die schwungvolle Ohrfeige, die sie gleich darauf in ein ihr wahrscheinlich zu nahe gekommenes Gesicht hemmungslos placierte. O ja, sie konnte beides. Sie konnte lumpensammelnde Kinder zärtlich mit Naschwerk traktieren und so manchen Prominenten umstandslos mit »Dummer Junge« anreden.
Ich habe sie im Verlaufe jener Jerusalemer Jahre geschlagene fünf Ohrfeigen verabreichen sehen, fünf geschlagene Ohrfeigen, ohne selbst eine davon abbekommen zu haben. Oder doch nur eine moralische. Von der aber erst später. Die besagten fünf Ohrfeigen indes verteilten sich folgendermassen: Eine bekam jener zudringliche Nachbar am Schuhputzerstand, eine weitere ein parkender Chauffeur, der der ahnungslos Vorübergehenden ein paar Kartätschen seiner international fundierten Batterie von Berufsflüchen in den Rücken jagte, die dritte eine unfreundliche Kellnerin, die zwar nicht zufriedenstellend bediente, dafür aber, wie das zuweilen so üblich ist, den Gast erziehen wollte, die vierte eine Dame aus der vornehmsten [25] Gesellschaft, die es bei einer ungebeten der Dichterin erteilten Hilfeleistung an rudimentärstem Feingefühl hatte fehlen lassen, und die fünfte schliesslich ein gutmütiger Passant, der der jämmerlich abgerissen herumlaufenden Frau – sie trug damals stark ramponierte Männerhosen – eine Kupfer- oder Nickelmünze in die Hand drücken wollte, offenbar nicht im Besitze eines geschärften Unterscheidungsvermögens. Bei der ersten dieser Ohrfeigen aber, wie gesagt, wusste ich noch nicht, von wem sie stammte.
Einige Wochen später erst wurde mir das klar, als ich eines Abends ein feierlich hergerichtetes Jerusalemer Antiquariat betrat, in dessen stimmungsvollem Rahmen Else Lasker-Schüler damals aus eigenen Werken las. Dort sass sie dann am Pult, klein, geduckt, in einem alten Sammetüberwurf, der nach Klassikerinszenierungen einer mittleren Bühne roch, das Gesicht vorgebeugt zwischen zwei mehr Düsterkeit als Helle verbreitende Kerzen, die in grossen Leuchtern zu beiden Seiten eines Jahrhunderte alten, angeknabberten Foliobandes aufgestellt waren, auf dem ihre Manuskripte lagen. Das ganze nahm sich ein wenig spirituistisch aus, mehr noch, als die Dichterin nun begann, zur Begleitung einer kleinen, von ihr selbst gehandhabten Leier eines ihrer schönsten und bekanntesten Gedichte, das von David und Jonathan, vorzutragen, dem sich nach einem Zwischenspiel aus der auch selbst dramatisierten Novelle »Arthur Aronymus und seine Brüder«, für die Else Lasker-Schüler in Deutschland noch 1932 mit dem Kleistpreis ausgezeichnet worden ist, später neue lyrische Schöpfungen anschlossen, Strophen von überschwänglichem Liebeszauber und [26] herber Todesahnung. Wir finden sie in dem bald darauf erschienenen letzten Buche der Dichterin: »Mein Blaues Klavier«.
Das Publikum an jenem Abend aber blieb lange abseits, es war kalt im Raum vor lauter Nichtteilnahme atmender Wesen. Das ging eine bange Weile so, bis zu einem gewissen, kaum beachteten und auch nicht näher zu umreissenden Kulminationspunkt, an dem das ganze Auditorium um 180 Grad schwenkte, aufhorchte, sich plötzlich mitreissen liess zu ungeahnten Höhen der Verinnerlichung. Es kam wie eine Offenbarung inmitten dieses Seiltanzes zwischen äusserster Faszination und bestürzender Lächerlichkeit, da diese unter anderem auch schon als geisteskrank und Simulantin bezeichnete Frau, wahrscheinlich ebenso oft in ihrem Leben verlacht wie vergöttert, Gesicht wurde, Erscheinung, raum- und sinnfüllende Allgegenwart. Da ihr Vortrag ganz Lied geworden, aus Worten geknüpft und doch schon längst nicht mehr abhängig von Worten, oder jedenfalls nicht von bestimmten, losgelöste Materie, Absage der Sinne und des Herzens an den blanken, nüchtern ordnenden Geist, ein Orkan der Empfindung. Das war der Eindruck, das Stigma des Erlebnisses. Keine seiner kleinsten Schwingungen und Nuancen habe ich vergessen.
Einige Tage später erhielt ich ein merkwürdiges Postkärtchen, als dessen Absender ich nach unverhältnismässig gründlichem Studium schliesslich Else Lasker-Schüler eruieren konnte. Sie hatte am Kopf der Adresse einen zierlichen, buntgefiederten Vogel hingemalt, darunter in schönen Buchstaben geschrieben: »Buildinghouse, Jerusalem«, dazu allerdings die richtige [27] Zimmernummer. Und da in der Heiligen Stadt selbst der Postverkehr einer mehr oder weniger familiären Einrichtung verräterisch nahekommt, hat er auch dies Kärtchen umstandslos an seinen Bestimmungsort, in meine Hände gelangen lassen. Die Karte, halb englisch, halb deutsch beschriftet, enthielt neben einigen rührenden Worten des Dankes für eine kleine Rezension die Einladung, welche besagte, dass ich mich an einem der folgenden Tage im prinzlichen Palast des Unterzeichnenden einfinden möge. Signiert war das Ganze lakonisch mit dem Namen Jusuf. Welch merkwürdige Berufung an den merkwürdigsten aller Fürstenhöfe!
Eiligst verwandle ich mich also, in meiner eigenen Vorstellung zumindest, in eine pseudonyme Märchengestalt, denke ebenso eilig meine allernächste Umgebung in eine Märchenwelt um und mache mich ungesäumt auf den Weg zum Palast des Dichter-Prinzen, einem kleinen, elenden Hotelzimmer, in dem es so gut wie nichts wahrzunehmen gibt, ausgenommen so etwas wie einen spezifischen Duft, eine Atmosphäre von hängenden, schwebenden Gedanken und Impulsen, wieder einmal beweisend, dass auch das kahlste Zimmer ein undefinierbares Etwas, gewissermassen das metaphysische Tapetenmuster seines Bewohners annimmt. So auch, und in stärkstem Masse, das Zimmer von Else Lasker-Schüler. Die Tür steht, da ich es zaghaft betrete, offen. Kein Mensch am Horizont. Ich habe Musse, mich umzusehen, während ich warte. Es gibt da nur wenige Gegenstände: einen Tisch, einen Diwan, eine alte Truhe, dahinter noch einen Koffer. Auf dem in orientalischer Manier geflochtenen [28] Schemel unterhalb des Fensterbretts befindet sich der Webstuhl dieser Werkstatt, die Schreibmaschine. Das ist so ziemlich alles. Dazu weht vielleicht noch ein Luftzug von Theben durchs Zimmer.
Jetzt tritt Jusuf ein. Wir grüssen einander mit stummer, doch vielberedter Verbeugung, wie das am Hofe von Theben wohl so die Sitte sein mag. Der Prinz, jetzt schon wieder die Dichterin Else Lasker-Schüler, wird schnell privat, in ihrer Weise nüchtern, alltäglich, obgleich sie noch immer zutiefst verträumt und abwesend wirkt. Das mag denn auch ihr beständigster Ausdruck gewesen sein; ich entsinne mich nicht, sie je anders gesehen zu haben.
Vorsichtig schliesst sie also die Tür, mir bedeutungsvoll zuflüsternd, dass auch diese Wirtin sie mit dem Leben bedrohte (mit der vorigen war es nicht anders), dann sprechen wir bald von Gott und der Welt, sie noch etwas mehr von Gott als ich von der Welt, trinken ein bisschen, rücken der hohen Politik auf den Leib, als plötzlich die Frage auf mich losschnellt: »Glauben Sie wirklich, dass sich das Ende des Krieges und das Ergebnis der unterirdischen Intrigen des Herrn von Papen aus den Sternen vorherberechnen lassen?« Ich bin ratlos, astrologisch nicht im mindesten vorbelastet, weiss nicht, was zu erwidern. Jedoch zwangsläufig, bereits eingewoben in die seltsame Diktion meines Gegenübers, weiss ich, wiewohl keineswegs, was ich antworte, so doch immerhin schon, wie ich es sage. Darauf kommt es denn schliesslich auch an. Man kann sich bei Else Lasker-Schüler mit jeder beliebigen Lösung aus der Affäre ziehen, es kommt einzig auf das Wie an. Da wir nun einmal [29] tief im Gespräch sind, erzählt die Dichterin kopfschüttelnd und ungläubig (»Gott, wie kann ein Mensch nur so herunterkommen«) von ihrem ehemaligen Freund und Gönner Benito Mussolini, den sie immer nur den Primaner nennt, und von dem sie nicht genug rühmen kann, wie er ihr bei jedem Besuch ihren nahezu klassischen »Tibetteppich« auswendig im Original hersagte. So plaudert sie noch eine schöne Weile fort, zum Schluss gewährt sie mir heimlich-verschämten Einblick in eine Stelle des gerade in Arbeit befindlichen Prosamanuskriptes »Tiberias«, dann trenne ich mich schweren Herzens. Es war eine herrliche Stunde wie so manche ihrer Art, die noch folgen sollten.
Etwa ein halbes Jahr später kam es zu der schon erwähnten moralischen Ohrfeige, und zwar folgendermassen: Die Dichterin wurde 65 Jahre alt, nach der bürgerlichen Zeitrechnung zumindest, die weder die Neider noch die Wohlwollenden begünstigt. Voller Emphase schrieb ich also einen grossen Aufsatz, den ich zum genauen Datum sogar ins Hotel bringen konnte – voller Emphase erhielt ich meine moralische Ohrfeige. Die Jubilarin lag krank im Bett, zerriss, als sie die Situation übersah, die Zeitung mit den Händen und mich mit den Augen, belegte mich dreifach mit ihrem sprichwörtlichen »Ich bin Achtzehn oder Tausend«, drohte mir rundheraus Selbstmord an, da ich sie nun an diese bürgerliche Gesellschaft verraten habe. Wer wollte der Erzürnten wohl entgegenhalten, dass eben die bürgerliche Gesellschaft sich nur an einen beliebigen Literaturkalender hätte halten müssen, um auch ohne meine Denunziation auf dem Laufenden zu sein? Der Schaden war nur durch einen neuen [30] Schaden gutzumachen.
So brachte ich der keineswegs Unversöhnlichen bei nächster Gelegenheit meine neuen Gedichte, die sie zur Kenntnis nahm mit den Worten: »Ich kann Gedichte überhaupt nicht leiden; aber ich freue mich, dass noch immer welche geschrieben werden.« Jetzt war alles wieder in Ordnung, der Frontalangriff auf ihre persönliche Zeitrechnung vergessen, die Beziehung absolut intakt.
Aber auch dabei blieb es nicht mit dieser schlechthin nur von Stimmung und Laune existierenden Frau. Schon bei nächster Gelegenheit befand sie es für gut, mich ein bisschen hereinzulegen, was ihr denn auch gelang. Ich hatte damals einige zwanzig Beiträge für den seinerzeit in Jerusalem erscheinenden »Ariel«-Almanach zu redigieren, stand, da diese Tätigkeit schon abgeschlossen schien, die Zusage der Beteiligung mit zwei Gedichten von Else Lasker-Schüler, die als einziger noch fehlte, in der Tasche, beim letzten Umbruch, dem Siedepunkt aller Publikationstechnik, in der Druckerei, als ich zu dem Bogen kam, für den ich die avisierten Strophen brauchte. Mehrmals war mir seitens der Dichterin versichert worden, ich bekäme zwei funkelnagelneue Liebeslieder, die eben im Begriff seien, ihr unterirdisch ins Bewusstsein zu strömen. Ich lief vom Umbruch fort und holte mir, was angeblich in selbiger Nacht entstanden war, als Preis meines geduldigen Wartens, warf es noch schnell in den Rotationsprozess des schon halbfertigen Buches und atmete erleichtert auf. – Nun, man möge sich den »Ariel«-Almanach einmal ansehen, und man wird bei einiger nicht ganz oberflächlicher Kenntnis der Produktion [31] von Else Lasker-Schüler feststellen können, dass sie mir damals, im September 41, da ich in besinnungslosem Umbruchstaumel nichts mehr vor den Augen sah, erfolgreich zwei Gedichte angedreht hat, die schon einmal in den zwanziger Jahren in ihren bekanntesten Büchern veröffentlicht worden waren ...
Das kommt, in kleinerem Massstab freilich, einer anderen kindlichen Eigenschaft dieser so mannigfach aus dem »normalen« Rahmen springenden Frau nahe, einem Akt von Trotz und Ambivalenz, von dem gewiss so manch Betroffener zu künden weiss. Bekanntlich malte die Dichterin auch, d. h. sie verstand nur, den Buntstift zu führen, mit dem sie allerdings sehr originelle und lebhafte Bildchen schuf. Diese Bilder verkaufte sie zuweilen. Es ist jedoch mehr als einmal passiert, dass sie zu einem der Käufer wenige Wochen später kam und ihr Bild zurückverlangte. Dies Verlangen setzte sie meistens auch durch, obgleich der jeweils so in Verlegenheit Gebrachte wahrscheinlich nie recht wusste, ob er sie mit dem schliesslichen Zurückgeben des Objektes mehr zufriedenstellte als beleidigte, ob er sie dadurch verletzte oder es ihr rechttat.
Es gäbe noch viele Beispiele für die ungebrochene Vitalität, mit der Else Lasker-Schüler bis in die letzten Tage ihres Lebens hinein ihr leidenschaftliches Vorhandensein, wahrscheinlich am entschiedensten sich selbst, demonstrierte. Ein letztes sei hier genannt. Noch vor knapp drei Jahren hat die schon ständig kränkelnde Frau in Jerusalem ein Forum für literarische Veranstaltungen, das sie mit stolzem Hinweis auf ihre Vorliebe für Indianerbrauch den »Kraal« benannt, ins [32] Leben gerufen. Da ging sie mit handgeschriebenen Plakaten und Eintrittskarten selbst zu allen Interessenten, beklebte alle Tafeln mit Bekanntmachungen, lud Dichter und Schauspieler zur Mitwirkung ein. Freilich passierte es bei diesen Veranstaltungen gelegentlich, dass ihr ein Besucher nicht passte, auf den sie dann mit grosser Gebärde zuging, das Eintrittsgeld ihm zurückerstattend und geradewegs die Tür ihm weisend ...
[...]
* * *
[*] Auszug aus: Manfred Vogel: Else Lasker-Schüler, ein Gedenkblatt. Tel Aviv: Edition »Refta«, 1945. 32 S.
Manfred Vogel (1923–1983), aus Berlin gebürtiger Schriftsteller und Journalist. 1939 emigrierte er nach Palästina und studierte in Jerusalem Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte. Er war Mitarbeiter an der Zeitschrift »Orient« und an der »Palestine Post«. Ab 1952 lebte er als Theater- und Kulturkritiker in Wien. 1943 besprach er in der hebräischen Tageszeitung »Mischmar« (Tel Aviv) (Jg. 2, Nr. 64 vom 15. Oktober 1943 [16. Tischri 5704]. S. 3) Else Lasker-Schülers Gedichtsammlung »Mein blaues Klavier«.